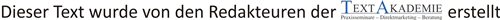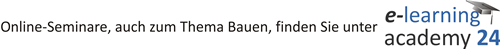1. Passivhaus – Funktionsweise

Eine gute Wärmedämmung ist wichtig für das Passivhaus.
Das Grundprinzip eines Passivhauses ist die Bewahrung der durch Sonnenstrahlung, Personen und Geräten eingebrachten Wärme. Das geschieht durch eine gute Wärmedämmung.
Fünf Grundprinzipien erklären, wie ein Passivhaus funktioniert.
- Eine gute Wärmedämmung von Fenstern, Wänden und Dach sorgt dafür, dass keine Wärme verloren geht.
- Die Vermeidung von Wärmebrücken. Das sind Teile des Gebäudes, die der kühlen Außenluft besonders ausgesetzt sind. Das sind zum Beispiel Gauben oder Erker. Auch die Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen sind unter Umständen Wärmebrücken.
- Eine luftdichte Gebäudehülle. So kann kein kalter Wind eindringen und das Material auskühlen.
- Einbau dreifach verglaster Fenster mit Edelgasfüllung. Oft kommen hier Argon oder Krypton zum Einsatz. Diese Gase dämmen besser als trockene Luft und ermöglichen einen geringen Abstand zwischen den Glasschichten.
- Ein Lüftungssystem, das mit Wärmerückgewinnung funktioniert. Die Luft wird mithilfe eines Erdwärmetauschers erwärmt und in die Räume eingespeist. Die Restwärme der abgesaugten Luft lässt sich zur Erwärmung der frischen Luft nutzen.
Das Passivhaus arbeitet ohne klassisches, wassergeführtes Heizungssystem. So sparen Sie Heizkosten. Besonders große Häuser verfügen oft über eine Zusatzheizung. Das ist auch in Klimazonen mit langen Winterzeiten sinnvoll. Hier bieten sich zum Beispiel eine Wandheizung oder eine elektrische Heizung sein.
2. Aktivlüftung und Heizung im Passivhaus
Voraussetzung für eine gute Aktivlüftung ist eine möglichst dichte Gebäudehülle. Diese Lüftungsanlagen sorgen für ein besonders angenehmes Raumklima und eine gute Luftqualität.
Dadurch, dass nicht durch die Fenster gelüftet wird, entsteht kein Wärmeverlust. Außerdem können dadurch Pollen und Staub nicht in die Zimmer gelangen. Die Lüftung tauscht die Raumluft alle 1 – 4 Stunden komplett aus. Ist die Aktivlüftung gut installiert und sind die Leitungen groß genug, ist sie außerdem geräuscharm und es entsteht kein Luftzug.

Die Lüftungsanlage ersetzt das Stoßlüften im Passivhaus. So geht keine Energie verloren.
Die erwärmte Luft wird in den Wohn- und Schlafzimmern zugeleitet, denn dort soll die Luftqualität am höchsten sein. Danach fließt die Luft über Überstromöffnungen, zum Beispiel unter Türen, in die Flure. Von dort strömt die Luft in Küchen, WCs und Badezimmer, von wo sie wieder abgesaugt wird. So verbreiten sich unangenehme Gerüche nicht im Haus.
Dann wird die Luft zum Wärmeübertrager geleitet, wo ihre Wärmeenergie zur Erwärmung der frischen Luft genutzt wird. So findet einen Wärmerückgewinnung von 80 – 95 % statt. Der Rotationsübertrager ist außerdem in der Lage, Luftfeuchtigkeit wiederzugewinnen. Der Einbau eines Pollenfilters sorgt für eine gute Luftqualität für Allergiker. Ein Ionisationsmodul mit Ionisisationsröhre verbessert die Luftqualität zusätzlich und baut Schadstoffe ab. Zum Schluss wird die Luft als Fortluft nach draußen geblasen.
Die Reinigung der Lüftungskanäle ist notwendig. Denn die feuchte warme Luft aus Küchen und Badezimmer durchströmt sie fortlaufend. Da die Reinigung relativ aufwendig ist, wird sie oft von Fachpersonal mit speziellen Instrumenten durchgeführt.
Heizung mit Sonnenwärme
Auch die großen, nach Süden ausgerichteten Fensterflächen tragen zur Heizung des Hauses bei. Der Restwärmebedarf kann beispielsweise durch eine Solaranlage oder Wärmepumpe gedeckt werden. Passivhäuser müssen nicht zwingend mithilfe einer Luftheizung beheizt werden. Das einzige Kriterium ist nur, dass sie unter einem Wärmeenergiebedarf von 10 kWh / m² pro Jahr bleibt. Werfen zum Beispiel große Bäume oder andere Gebäude ihre Schatten, erschwert das die Heizung der Räume.
3. Passivhaus – Voraussetzungen für den Bau
Wenn Sie ein Passivhaus planen, sind zunächst diese Punkte zu beachten:
- Gute Sonnenlage, keine schattigen Grundstücke.
- Am besten sind Passivhäuser nach Süden ausgerichtet, um die Wärmeenergie der Sonne ideal zu nutzen.
- Auf der Südseite befinden sich große Fensterfronten. Die Fenster zur Nordseite sind dagegen möglichst klein.
- Die Scheiben sind dreifachverglast und mit Edelgas gefüllt. Denn Edelgas hat bessere Dämmfähigkeiten als normale Raumluft. Auch die Rahmen sind gedämmt.
- Die Räume werden an die Fensterverteilung angepasst. Die Wohnräume befinden sich so häufig auf der Südseite. Räume wie Abstellkammern, WCs und Büros befinden sich häufig auf der Nordseite.
- Achten Sie auf eine möglichst kompakte Bauweise ohne überflüssige Kanten, Ecken und Anschlüsse.
- Vermeiden Sie Erker, Vor- und Rücksprünge in der Fassade und Gauben. Denn sie bieten zusätzliche Möglichkeiten für Wärmeverluste.
- Möglichst kleiner A/V Wert. Das A/V Verhältnis beschreibt das Verhältnis von Außenoberfläche zum beheizten Gebäudevolumen. Je größer die Wärmeübertragung nach draußen ist, desto größer der Wert.
- Die Gebäudehülle ist wind– und luftdicht. So sind die Luftwärmeverluste so gering wie möglich.
- Passivhäuser bestehen aus Holz oder werden als Massivhaus gebaut. Allerdings ist das Bauen mit Holz etwas teurer.
- Für die Dämmung von Passivhäusern kommen verschiedene Dämmstoffe zum Einsatz. Zweischaliges Mauerwerk aus Kalksandstein oder Porenbeton eignen sich wunderbar. Etwas moderner ist die Verwendung von PS-Dämm-Granulat, Vakuumisolationspaneelen und Schaumglasschotter.
4. Das Passivhaus als Innovation
Passivhäuser liegen voll im Trend, denn sie haben einen geringen Energieverbrauch. Außerdem kommen beim Bau mit Holz Fertigteile zum Einsatz. Intelligente Systeme sorgen dafür, dass das Haus mittels Sensoren auf das Wetter reagiert. So heizen Sie wirklich nur dann, wenn es unbedingt nötig ist und sparen zusätzliche Energie.
5. Passivhaus – Umweltbilanz

Das Passivhaus wird nach Süden ausgerichtet und mit großen Fensterfronten ausgestattet.
Passivhäuser verfügen über eine gute Umweltbilanz, da sie wenig Energie verbrauchen. So ist eine völlige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen möglich. Das Passivhaus lässt sich gut mit anderen ökologischen Baumaßnahmen kombinieren.
Der Passivhaus-Standard geht ideal auf die Forderung der EU nach „nearly zero energy buildings“ (Nahe-Null-Energiehäusern) ein. Dies soll 2020 für alle öffentlichen Gebäude und ab 2021 für alle Neubauten realisiert werden.
6. Kosten und Wirtschaftlichkeit eines Passivhauses
Beim Bau eines Passivhauses haben Sie zunächst mit zusätzlichen Investitionen zu rechnen, die sich aber langfristig rechnen.
Die Mehrkosten beim Bau eines Passivhauses sind folgende:
- Dämmung der Wände und Fenster.
- Einbau der Lüftungstechnik.
- Aufwendige Anschlussarbeiten.
Die Minderkosten sehen so aus:
- Bei Passivhäusern kann auf Heizungen und damit Heizungsräume verzichtet werden.
- Außerdem brauchen Sie sich keine Gedanken um Kamine zu machen.
- Die Kosten für Warmwasser und das Heizen der Räume bleiben gering.
Baukosten für ein Passivhaus
- Die Baukosten für ein Passivhaus belaufen sich auf ca. 1.750 € pro m² Wohnfläche.
- Bei Sanierung eines bestehenden Hauses sind die Kosten ungefähr 12 % bis 18% höher als bei einer durchschnittlichen Sanierung.
- Bei einem Neubau sind die Mehrkosten geringer, nämlich bei ungefähr 5 – 15 %.
- Ein weiterer großer Kostenpunkt ist die Installation der Lüftungsanlage, die 6.000 – 10.000 € kostet.

Ein Passivhaus ist anfangs eine Mehrinvestition, rechnet sich aber langfristig.
Betriebskosten für ein Passivhaus
Die Betriebskosten sind gering. Denn sie setzen sich aus dem Stromverbrauch für die Lüftung und die Zusatzheizung zusammen. Bei neuestem Baustandard ist die Ersparnis bei den Heizkosten mit ungefähr 75 % enorm.
Wartungskosten für ein Passivhaus
Die Wartungskosten drehen sich hauptsächlich um die Lüftungsanlage. Die Filter der Filteranlage werden regelmäßig ausgetauscht. So schützen Sie die Entfeuchtungstechnik vor Keimen.
Auch einen regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Lüftungskanäle ist notwendig.
Baumängel wie zum Beispiel Lecks in der eigentlich dichten Gebäudehülle sind gefährlich. Denn an ihnen konzentriert sich die Feuchtigkeit. Und das fördert die Schimmelbildung.
Wirtschaftlichkeit eines Passivhauses
Ab wann sich ein Passivhaus rechnet, hängt von der Entwicklung der entsprechenden Energieträger ab. Experten sprechen aber von einem Zeitraum von vier bis zehn Jahren.
Aufgrund der Klimaziele der EU sind Baukonzepte besonders zukunftsweisend. Denn sie sind energiesparend und können sich auf regenerative Energien verlassen. Sie können also sicher sein, dass Sie mit einem Passivhaus eine zukunftsbewusste Entscheidung treffen.
Fördermöglichkeiten für den Bau eines Passivhauses

Wenn Sie ein Passivhaus bauen, haben Sie Anspruch auf Förderung.
Die KfW Förderbank bietet deutschlandweit Zuschüsse und Kredite für Baumaßnahmen, die zur Energieersparnis beitragen. Das geschieht im Rahmen des Förderprogramms „Energieeffizientes Bauen“. Darunter finden Sie beispielsweise das KfW-Effizienzhaus 55 mit der Programmvariante „Passivhaus“.
Sie erhalten Förderungen von höchstens 50.000 € je Wohneinheit. Dabei werden sogar teilweise 100 % der Bauwerkskosten gefördert. Das bebaute Grundstück ist dabei aber natürlich nicht eingeschlossen.
Ihr Darlehen erhalten Sie innerhalb eines Jahres nach der Zusage in der Summe oder in kleineren Beträgen. Diese Mittel sind in den ersten drei Monaten nach der Auszahlung zu verwenden. Danach gibt es Zinszuschläge und eine Bereitstellungsprovision.
Fragen Sie außerdem nach regionalen Förderprogrammen der Länder, Gemeinden oder Energieversorger.
7. Vorteile und Nachteile eines Passivhauses
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Energie-, Nebenkosteneinsparungen. | Hohe Baukosten. |
| Konstante Raumtemperatur im Sommer wie im Winter. | Kein fühlbares Wärmeerlebnis wie bei herkömmlichen Heizungen. |
| Gute Luftqualität: Kein Staub, keine Pollen. Gut für Menschen mit Allergien. | Architektonische Einschränkungen. Möglichst kompakte Bauweise. |
| Geringes Risiko für Feuchtigkeits- und Schimmelbildung. | Hohe Reparaturkosten bei Schäden. |
| Gute Ökobilanz, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. | Herstellung des Dämmmaterials nicht immer umweltfreundlich. |
Vor- und Nachteile von Passivhäusern in Holz- und Massivbauweise
Passivhäuser werden aus Holz oder in Massivbauweise errichtet. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der Bauweisen und Materialien.

Holz als nachwachsender Rohstoff passt gut zum Passivhaus.
Passivhäuser aus Holz bieten viele Vorteile:
- Sie lassen sich schnell bauen, denn es kommen Fertigteile zum Einsatz.
- Aus diesem Grund entstehen auch weniger Fugen. So lässt sich eine Luftdichtheit Ihres Hauses gut realisieren.
- Die verbleibenden Fugen sind dann einfach dämmbar.
- Fertigteile gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. So haben Sie gestalterische Freiheit.
- Mit einem Passivhaus aus Holz haben Sie ein witterungsunabhängiges gutes Raumgefühl.
- Mit dem richtigen Holz als nachwachsendem Rohstoff treffen Sie eine umweltbewusste Entscheidung. Denn Holz hat eine gute Ökobilanz.
Passivhäuser aus Holz haben allerdings auch einige Nachteile.
- Holz ist nicht schalldicht. Wohnen Sie in einer lauten Umgebung, sind zusätzliche Maßnahmen zum Lärmschutz erforderlich.
- Außerdem haben Sie Vorkehrungen zum Brandschutz Ihres Holzhauses zu treffen.
- Holz nimmt Wasser auf. Deswegen werden die Innenräume Ihres Passivhauses mit einer Dampfsperre vor Feuchtigkeit geschützt. Diese Schicht in der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt.
- Holz ist als Naturprodukt außerdem anfälliger für Schädlinge als andere Baustoffe.
Für wen ein Passivhaus aus Holz nichts ist, der freundet sich vielleicht mit einer Massivbauweise an.

Ihr Passivhaus kann auch in Massivbauweise errichtet werden.
Zu den Vorteilen eines massiven Passivhauses gehören folgende Punkte:
- Durch eine Massivbauweise ist die bei Passivhäusern wichtige Dichtheit leicht zu erreichen.
- Massivhäuser sind sehr belastbar und stabil. Sie überdauern mehrere Generationen.
- Massivhäuser sind grundsätzlich schall- und brandgeschützt.
Allerdings gibt es auch hier einige Nachteile.
- Der Energiebedarf zur Herstellung der Baustoffe ist hoch. Das hat einen negativen Einfluss auf die Ökobilanz Ihres Passivhauses.
- Rechnen Sie mit einem hohen Arbeitsaufwand, wenn Sie Ihr Passivhaus in Massivbauweise errichten.
8. Passivhaus und Niedrigenergiehaus im Vergleich
Niedrigenergiehäuser zeichnen sich durch eine gute Dämmung aus, sodass Sie weniger heizen müssen. Passivhäuser gehen noch einen Schritt weiter und sind noch besser wärmegedämmt. So brauchen Sie gar keine Heizung.

Das Passivhaus ist besser wärmegedämmt als Niedrigenergiehaus. Deswegen ist es energiesparender.
Hier finden Sie einen übersichtlichen Vergleich von Passivhäusern und Niedrigenergiehäusern.
Ein erster großer Unterschied ist der Heizwärmebedarf pro Jahr. Niedrigenergiehäuser werden bis zu einem Bedarf von 50 kWh / m² als solche klassifiziert. Passivhäuser dagegen schlagen mit einem Heizwärmebedarf von lediglich 15 kWh / m² zu Buche. So sind sie energiesparender als Niedrigenergiehäuser.
Ein Passivhaus braucht zu Dämmzwecken eine dicke Gebäudehülle von circa 50 cm. Das reduziert die Nutzfläche Ihres Hauses. Die Wände eines Niedrigenergiehauses sind mit circa 35 cm dünner und lassen mehr Fläche zur freien Verfügung.
Weil ein Passivhaus Wärmeverluste durch Wärmebrücken vermeidet, sind Erker oder Gauben keine gute Idee. Die möglichst kompakte Bauform eines Passivhauses schränkt die Planungsfreiheit ein. Außerdem werden Passivhäuser immer nach Süden ausgerichtet und mit großen Fensterfronten an der Südseite ausgestattet.
Bei der Planung eines Niedrigenergiehauses sind diese Maßnahmen auch von Vorteil, aber nicht unbedingt nötig. Wenn Sie beispielsweise die Aussicht nach Norden genießen möchten und auf der Südseite eine Straße eng am Haus verläuft, ist ein Niedrigenergiehaus für Ihr Bauprojekt besser geeignet.
Wie bereits erwähnt, hat ein Passivhaus keine klassische Heizung. Es wird mithilfe von Wärmerückgewinnung belüftet. Niedrigenergiehäuser erfordern in der Regel keine Lüftungsanlagen und lassen sich mit wassergeführten oder elektrisch betriebenen Heizungen beheizen.
Der Bau von Passivhäusern wird besser gefördert als der Bau von Niedrigenergiehäusern.
Die EU-Gebäuderichtlinie von 2010 (mit Ergänzungen von 2018) sieht ab dem Jahr 2021 einen Heizwärmebedarf von unter 40 kWh / m² pro Jahr. Das erreichen nur manche Niedrigenergiehäuser. Passivhäuser unterschreiten diesen Wert bei weitem.